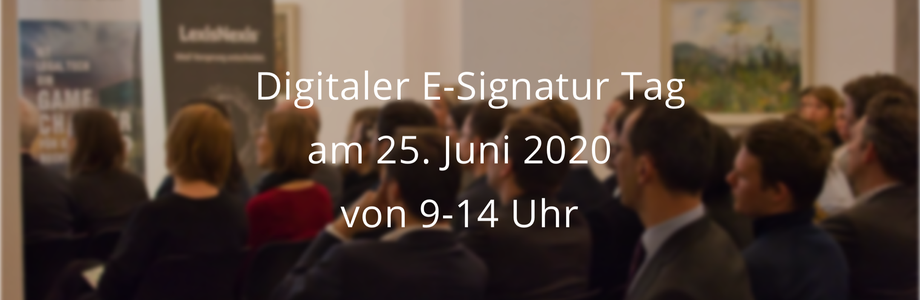
25.06.2020 digitaler E-Signatur-Tag

.... fordern Sie den Rabattcode an
... besuchen sie uns auch auf Twittter & Facebook & LinkedIn oder XING
aktuelle Blogeinträge auf dataprotect
Einwilligungen und Kundenbindungsprogramme können zu erheblichen Geldstrafen führen
BVwG bestätigt Schuldspruch wegen Verstoß gegen den Erleichterungsgrundsatz bei der Ausübung von Betroffenenrechten nach der DSGVO, reduziert jedoch Strafe
Eine Terminbestätigung im Gesundheitswesen als Gruppennachricht kann eine DSGVO-Strafe von EUR 4.000,-- auslösen
Datenschutzrechtliche Stellung des Gerichtsvollziehers: Höchstgerichtliche Klärung durch den VwGH

LeadersLeague empfiehlt dataprotect schweiger.legal im Bereich Innovation, technology & telecoms Data protection in Österreich
Dr. Thomas Schweiger beantwortet Fragen zum Einsatz von KI in der Hausverwaltung

Schadenersatz nach Art 82 DSGVO - wie hoch muss die erlittene Beeinträchtigung sein - der EuGH sagt: Befürchtungen des Datenmissbrauches können ausreichen!

Die Salzburger Nachrichten berichten am 21. Juni 2024 über ein Google Fonts Verfahren - am 27.9.2024 geht es beim LG ZRS Wien im Musterverfahren weiter
Eine geschädigte Person will Auskunft vom Schädiger, um die Prozessposition einschätzen oder verbessern zu können - Rechtsmißbrauch oder Anspruch nach Art 15?

VfGH hob Bestimmungen zur Sicherstellung und Auswertung von Datenträgern als verfassungswidrig auf - Die Beschlagnahme von Handys ist ab 1.1.2025 neu zu regeln
Google Fonts Verfahren - Update: Unterlassungsverfahren auch in der 2. Instanz gewonnen

Künstliche Intelligenz und die rechtlichen Schranken - ein Artikel in den Oberösterreichischen Nachrichten vom 07.06.2024
Die Weiterleitung der E-Mail-Korrespondenz zwischen Eigentümer:in und Hausverwaltung an externe Unternehmen verletzt das Recht auf Datenschutz

